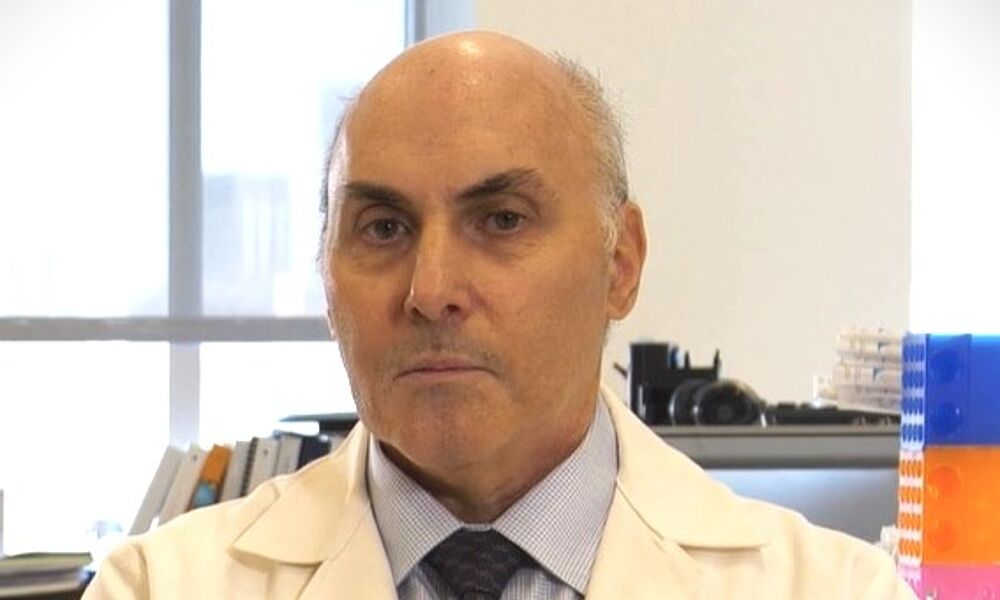Prägende Zeitereignisse
Medizin-Nobelpreis für Corona-Forschende Katalin Karikó und Drew Weissman
Katalina Karikó und Drew Weissman sind Biochemiker. Ihnen ist zu verdanken, dass es nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie innerhalb kurzer Zeit Corona-Impfstoffe gab. Diese Leistung ist am 2. Oktober 2023 mit der Verleihung des Nobelpreises für Medizin gewürdigt worden.
Da ich selber (zugegebenermassen vor langer Zeit) Molekularbiologie und Biochemie studiert habe, können Sie vielleicht nachvollziehen, weshalb mich dieser Erfolg persönlich fasziniert.
Die Geschichte hinter dieser Ehrung begeistert mich aber auch als Pädagoge, der ich heute bin. Sie ist so eindrücklich, dass sie Erwähnung verdient.
Die wissenschaftliche Leistung
Alle während der Pandemie gegen das Corona-Virus entwickelten Impfstoffe basieren auf sogenannter «messenger RNA» (kurz: mRNA). Das sind molekulare Produktionsanleitungen für Proteine (Eiweisse). Im Falle der Corona-Impfstoffe waren es Produktionsanleitungen für Oberflächenproteine der Corona-Viren. Diese Oberflächenproteine veranlassen die körpereigene Immunabwehr, Antikörper gegen dieses fremde Protein zu bilden. Damit beginnt die Immunabwehr.
Das Problem: mRNA ist sehr empfindlich. Sie wird im Organismus sehr schnell abgebaut. Die erste Herausforderung besteht also darin, die mRNA gegen die sofortige Zerstörung zu schützen. Die zweite Herausforderung besteht darin, die stabilisierte Bauanleitung im geimpften Organismus in jene Zellen hineinzubringen, welche die Oberflächenproteine dann zu produzieren beginnen.
Die Lebensleistung
Katalina Karikó ist 1955 in bescheidenen Verhältnissen in Ungarn geboren. In ihrer Biografie («Breaking Through: My Life in Science») schildert sie, dass sie in der Schule keine «Überfliegerin» gewesen sei, dass sie aber gelernt habe, durch Fleiss und harte Arbeit eine gute Schülerin zu sein. So hat sie sich einen Studienplatz an der Universität von Szeged (Ungarn) erkämpft, wo sie auch promoviert und als Postdoc ein mRNA-Labor aufgebaut hat.
Die mRNA-Forschung hat damals in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und bei Investoren nicht viel Aufmerksamkeit erhalten. (Das Hauptinteresse der Welt lag damals auf der Erforschung von Genen und Generkrankungen und damit auf der DNA.) Entsprechend fiel es Katalina Karikó auch schwer, ihre Arbeit zu finanzieren. Aufgrund fehlender finanzieller Zuwendungen wurde ihre Forschung an der Uni Szeged bereits nach wenigen Jahren nicht mehr unterstützt. Sie sah sich gezwungen, mit Mann und Tochter auszuwandern. An der University of Pennsylvania gelang es ihr, eine schlecht bezahlte Assistenzprofessur zu ergattern. Auch hier blieb sie mit ihrer Arbeit weitgehend unbeachtet und unzureichend finanziert. Und auch diese Stelle wurde letztlich aufgrund unzureichend fliessender Drittmittel gestrichen.
Beeindruckend finde ich, wie Katalina Karikó trotzdem ein Berufsleben lang beharrlich und konsequent an dem sie interessierenden Thema drangeblieben ist. Erstens glaubte sie fest daran, etwas Wichtigem, was vielen Menschen helfen könnte, auf der Spur zu sein. Zweitens (und wahrscheinlich noch viel wichtiger) liebt sie, was sie tut. Das ist ihr «Geheimnis». Wer liebt, was er oder sie tut, strebt danach, immer besser zu werden.
An einem Kopiergerät der University of Pennsylvania lernte sie Drew Weissman kennen, einen Kollegen, der sich auf Immunologie spezialisiert hatte. Sie verstand nicht viel von Immunologie. Er kannte sich mit mRNA nicht aus. Weissman überzeugte Karikó, mit ihm zusammen an mRNA-Impfstoffen zu arbeiten. Zusammen gelangen ihnen Durchbrüche, die sie alleine nicht hätten erreichen können.
Der Nobelpreis für Medizin, den die beiden Forschenden am 2. Oktober 2023 erhalten haben, krönt ein Lebenswerk, das während Jahrzehnten unter schlechten Bedingungen, mit Entbehrungen und geringer Wertschätzung geleistet wurde, das aber unzählige Leben gerettet hat und letztlich Umarmungen wieder möglich gemacht hat.
Prof. Peter Heiniger
Direktor NMS Bern
Künstliche Intelligenz (KI) – beschleunigte Entwicklung
Im letzten Jahresbericht (2022/23) haben wir uns entschieden, das KI-Sprachmodell «Chat GPT» als «prägendes Zeitereignis» aufzulisten. Eine Gratisversion (Version 3) ist am 30. November 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Obwohl KI (Künstliche Intelligenz) schon seit der Mitte der 1960er-Jahre entwickelt und im Alltag zunehmend eingesetzt wird (z.B. in Internet-Stores, bei Musik-, Video- oder Film-Streamings, bei den Passkontrollen an Flughäfen oder in Form von Sprachassistenzen wie «Siri» oder «Alexa»), haben viele dieser Entwicklung keine besondere Beachtung geschenkt. Mit der Veröffentlichung von ChatGPT-3 wurde KI jedoch schlagartig zu einem breit und kontrovers diskutierten Thema. Auch an der NMS Bern.
Was hat sich seit dem November 2022 in diesem Feld getan? Die kurze Liste lässt erahnen, mit welcher Dynamik wir in den kommenden Jahren rechnen müssen:
- Fast im Monatstakt ist ChatGPT-3 in gewissen Bereichen verbessert und in neuen Versionen veröffentlicht worden.
- Bereits im März 2023 kam die (kommerzielle) Version 4 mit deutlichen Verbesserungen auf den Markt. Diese Version verarbeitet auch Bilder und Videos. Sie kann abfotografierte Texte lesen und so beispielsweise auch Aufgaben aus (Schul-) Büchern lösen.
- Ebenfalls seit Ende März 2023 können Drittanbieter mit ChatGPT-4 Apps entwickeln, die weitere Einsatzmöglichkeiten bieten. Diese Apps können sie dann in einem «Plugin-Store» (einer Art «App Store» für ChatGPT-Apps) anbieten.
- Im November 2023 kam der «GPTBuilder» auf den Markt. Mit ihm kann man auch ohne Programmierkenntnisse mit Hilfe von Voreinstellungen selber einen Chatbot aufsetzen.
- Im Mai 2024 folgte mit ChatGPT-4o wieder ein Gratistool (allerdings mit limitierter Anzahl der Eingaben). Diese Version erlaubt eine Kommunikation mit dem Bot fast in Echtzeit. Er erkennt auch Bilder und Videos noch besser.
Als Bildungsinstitution haben wir diese Entwicklung nicht nur zum Anlass genommen, um die Lehrpersonen zu Fragen des Einsatzes von KI in Lern-Lehr-Settings weiterzubilden und unsere Haltung gegenüber KI-Tools in Lern-Lehr-Prozessen zu klären. Wir haben uns auch mit interessierten Eltern ausgetauscht, und zwar am 26. Oktober 2023 anlässlich eines «pädagogischen Kaminfeuergesprächs». Unter dem Oberthema «Zukunft des Lernens. Einfluss der Digitalisierung auf das Lernen an der NMS Bern» wurden dabei Thesen diskutiert und dialogisch geschärft. Diese Thesen wurden anschliessend den Kollegien der drei Schulabteilungen vorgelegt. Dort sollen sie im Rahmen der abteilungsbezogenen Schulentwicklungsprozesse die Lehrpersonen beim Entwickeln von «individualisierenden Lerneinheiten (iLE)» begleiten.
Für uns ist klar: Je mehr digitale Tools die Alltagswelt unserer Lernenden durchdringen, umso wichtiger ist es, dass sich auch die Schule damit auf möglichst vielen Ebenen medienpädagogisch und didaktisch auseinandersetzt. Deshalb scheint es uns legitim, die KI auch dieses Jahr als «prägendes Zeitereignis» hervorzuheben.
Ebenso klar ist für uns, dass es in einem Umfeld zunehmender Digitalisierung besonders wichtig wird, auch ganz bewusst die analoge Welt mit echten Begegnungen, direkter Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, echter Handarbeit und selber kreierten Lösungen zu pflegen.
Prof. Peter Heiniger
Direktor NMS Bern
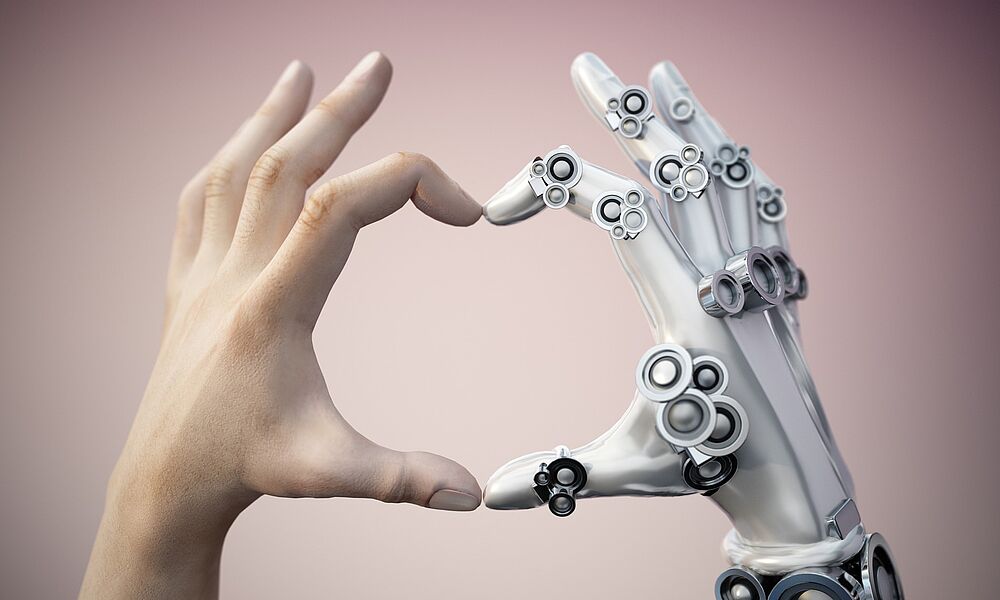
Angriff der Hamas auf Israel. Beginn eines neuen, schrecklichen Kapitels einer Dauertragödie.
Es braucht viel historisches Wissen, um den Nahostkonflikt wenigstens in groben Zügen nachvollziehen und auf der Faktenebene verstehen zu können. Ein emotional distanzierter Blick auf die Abfolge der Ereignisse und die Logik dieses Konflikts, der mal heisser und mal kühler ausgetragen wird, gelingt wahrscheinlich nur persönlich nicht Betroffenen, die kein Stück dieses jahrzehntewährenden Horrors erlebt haben, die keine Verluste erlitten haben und die keinen Schmerz mit sich herumtragen. , . Auch das ist ein Problem.
Was auffällt: Die Gegner kennen sich kaum, obwohl sie im gleichen Land geboren und aufgewachsen sind. Auch das gehört zur Logik von Konflikten. Das ist sogar ein Grundprinzip der «Konfliktbewirtschaftung» – nicht nur in diesem Krieg. Wer den Konflikt will, muss den Gegner entmenschlichen. Dieses Prinzip können wir auch vor unserer Haustüre beobachten. Und dagegen kann man als Individuum mit Offenheit und Neugierde etwas machen.
Auch dies war eines unserer Motive, weshalb wir am 2. Mai 2024 einen abteilungsübergreifenden Projekttag unter das Motto «NMS grenzenlos: Erleben und Erfahren von Internationalität” gestellt haben. In einer stetig komplexer werdenden Welt, die zugegebenermassen unzählige Probleme und damit auch Konfliktpotential bereithält, sind persönliche positive Erfahrungen mit anderen Menschen der wirksamste Schutz gegen Hetzer. So kann man sich besser auf das Lösen von Problemen konzentrieren.
Prof. Peter Heiniger
Direktor NMS Bern